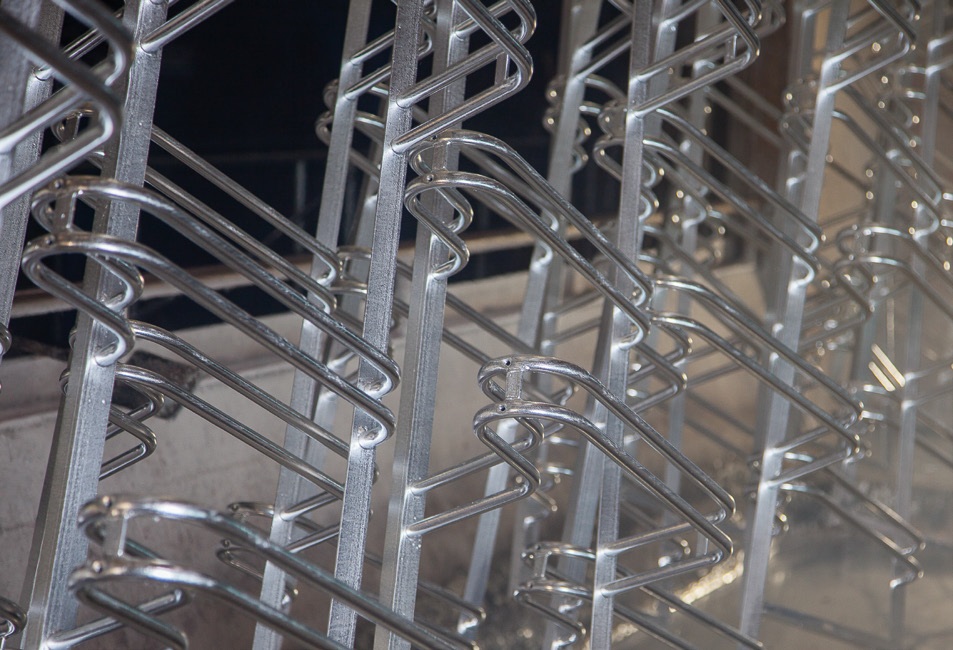Die Unterschiede in Theorie und Praxis
In der Oberflächentechnik kommen verschiedene Verfahren zur Anwendung, die den Korrosionsschutz und die Funktionalität metallischer Werkstoffe verbessern sollen. Dazu gehören auch das Chromatieren und das Passivieren. Beide verfolgen ähnliche Ziele, unterscheiden sich jedoch hinsichtlich ihrer chemischen Grundlage, ihrer Wirkungsweise und der möglichen Einsatzfelder. Erfahren Sie hier bei Kluthe mehr zum Unterschied beider Methoden und warum die Entscheidung Passivieren oder Chromatieren mehr als nur eine Materialfrage ist.
Chemische Grundlagen von Passivierung und Chromatierung
Sowohl das Passivieren als auch das Chromatieren basieren auf Oberflächenreaktionen, bei denen die äußeren Schichten des Metalls in einen inaktiven Zustand versetzt werden. Dabei wird die natürliche Oxidschicht verstärkt und zugleich eine neue Schutzschicht aufgebaut. In beiden Verfahren geht es darum, Sauerstoff- und Feuchtigkeitseinwirkung zu minimieren und Korrosionsprozesse aufzuhalten.
Wirkprinzip der Passivierung
Beim Passivieren wird die Oxidschicht auf dem Metall mithilfe oxidierender Mittel wie Nitrit oder Permanganat chemisch umgewandelt und verdichtet. Dabei entsteht ein dünner, sehr dichter Schutzfilm, der die Metalloberfläche gegen elektrochemische Einflüsse abschirmt. Die Passivierungsschicht ist meist farblos bis leicht perlmuttschimmernd. Es gibt aber auch Blaupassivierungen auf Chrom(III)-Basis, die hellblaue Farben erzeugen.
Wirkprinzip der Chromatierung
Das Chromatieren beruht auf der Bildung von Chrom-Verbindungen auf der Metalloberfläche. Eine Chromatlösung reagiert mit dem Metall. Das Resultat ist eine mehrlagige Konversionsschicht, die neben passivierenden auch selbstheilende Eigenschaften besitzt. Kleinste Defekte verschließen sich durch nachgelagerte Chromatierungsreaktionen, wodurch sich die Langzeitkorrosionsbeständigkeit deutlich erhöht. Die Farbvarianten reichen von Gelb (Gelbchromatierung) über Olivgrün (Grünchromatierung) bis hin zu Schwarz (Schwarzchromatierung).
Prozessschritte beim Chromatieren und Passivieren
Ob es um das Passivieren oder Chromatieren eines Werkstücks geht, bedeutet für den Prozess selbst keinen großen Unterschied. Beide Varianten folgen einem standardisierten, für Konversionsverfahren typischen Ablauf.
Dieser besteht in aller Regel aus folgenden Schritten:
- Reinigen und Entfetten: Die Metalloberfläche wird von Fetten, Ölen und Partikeln befreit, um eine gleichmäßige Reaktion sicherzustellen.
- Aktivieren (optional): Bei einigen Materialien ist Beizen erforderlich, etwa bei Edelstahl zum Entfernen der natürlichen Oxidschicht.
- Behandeln in der Passivierungs- bzw. Chromatierungslösung: Das Werkstück wird in die Lösung eingetaucht oder mit dieser besprüht. Durch eine chemische Reaktion entsteht eine Konversionsschicht auf der Metalloberfläche.
- Spülen: Um unerwünschte Reaktionen und Fleckenbildung zu vermeiden, werden die Rückstände der Lösung gründlich mit Wasser abgespült.
- Trocknen: Zum Stabilisieren der Schutzschicht werden die Teile luft- oder warmluftgetrocknet.
Sowohl beim Chromatieren als auch beim Passivieren spielt die chemische Zusammensetzung der eingesetzten Lösungen eine zentrale Rolle. Traditionell wurde die Chromatierung mit Chrom(VI)-Verbindungen durchgeführt, mit denen sich besonders wirksame, farbintensive Schutzschichten erzeugen lassen. Aufgrund ihrer toxischen, umweltgefährdenden Eigenschaften ist ihr Einsatz inzwischen nur noch mit explizit erteilter Ausnahmegenehmigung gestattet, was einem faktischen Verbot gleichkommt. Moderne Chromatierungsverfahren setzen daher auf Chrom(III)-basierte Lösungen, die zwar einen leicht geringeren Schutz vor Korrosion bieten, aber deutlich umweltfreundlicher und gesetzeskonform sind.
Beim Passivieren kommen meist chromfreie oder Chrom(III)-haltige Lösungen zur Anwendung, die speziell für Edelstahl, Aluminium oder Zinklegierungen entwickelt wurden. Der damit erzielte Korrosionsschutz reicht für viele Einsatzfelder aus, erreicht aber nicht ganz die Leistung von Chromatierungen. Aus umwelttechnischer Sicht sind Passivierungsverfahren wie die REACH-konformen Blaupassivierungen im Vorteil.

Materialkompatibilität und Oberflächeneigenschaften im Vergleich
Ob das Passivieren oder das Chromatieren die jeweils bessere Lösung ist, hängt in erster Linie vom Werkstoff und den gewünschten Oberflächeneigenschaften ab. Die Passivierung eignet sich vor allem für Edelstahl und Aluminiumlegierungen, die auf natürliche Weise eine Oxidschicht ausbilden. Chromatieren ist ideal für galvanisch verzinkte Teile, stark beanspruchte Aluminiumbauteile und weitere unedle Metalle.
Passivierte Metalloberflächen bieten durch ihre glatte, geschlossene Oberfläche eine optimale Basis für dekorative Beschichtungen, erfordern jedoch oft zusätzliche Haftvermittler, um eine ausreichende Adhäsion zu bewirken. Chromatierte Schichten weisen mikroskopisch feine Rauheiten und Rissnetzwerke auf, wodurch sich ihre Benetzbarkeit für Schmierstoffe und die Haftung von Folgelacken, Klebstoffen und Dichtmitteln verbessern.
Das Passivieren hat kaum einen Einfluss auf die elektrische Leitfähigkeit des Metalls, da die dünne Oxidschicht nur minimal isolierend wirkt. Der mechanische Verschleißschutz ist jedoch begrenzt, da die Passivierungsschicht kein Selbstheilungsvermögen aufweist. Im Unterschied dazu zeigen chromatierte Oberflächen aufgrund der dickeren Konversionsschichten eine leicht verringerte Leitfähigkeit, punkten aber mit mechanischer Robustheit.
In Bezug auf den Korrosionsschutz hat die klassische Gelbchromatierung mit Chrom(VI) die höchste Schutzwirkung, vor allem bei Zinkoberflächen. Die auf Chrom(III) basierende Schwarzchromatierung erzeugt ebenfalls gute Werte, verliert jedoch hinsichtlich der Langzeitstabilität. Passivierungen, insbesondere chromfreie Varianten, bieten einen soliden Korrosionsschutz und eine hohe Verträglichkeit gegenüber Klebstoffen und Lacken.

Relevante DIN-Normen für das Chromatieren und Passivieren
Für das Chromatieren und Passivieren metallischer Oberflächen gelten verschiedene DIN-Normen, die sowohl die Beschichtungsverfahren als auch die Prüfmethoden und Qualitätsanforderungen regeln. Relevant ist vor allem die DIN EN ISO 4520. Diese befasst sich mit Chromat-Konversionsüberzügen auf elektrolytisch abgeschiedenen Zink- und Cadmiumschichten und setzt internationale Standards für Verfahren wie die Gelbchromatierung und Schwarzchromatierung.
Für die Passivierung nicht rostender Stähle ist die DIN EN 10088 von Bedeutung, die technische Lieferbedingungen und Hinweise zur Nachbehandlung, beispielsweise mittels Blaupassivierungen, inkludiert. Ebenfalls wichtig ist die DIN EN ISO 3613, die Prüfverfahren für Chromatierüberzüge auf Zink, Aluminium und deren Legierungen beschreibt, und damit für alle genannten Varianten anwendbar ist.

Chromatieren vs. Passivieren: Auswahlkriterien und Praxistipps
Bei der Wahl zwischen dem Passivieren und dem Chromatieren stehen die konkreten Anforderungen an das Material, die Einsatzumgebung und die Weiterverarbeitung im Vordergrund. Entscheidend sind die Legierungszusammensetzung des Metalls, die erforderliche Korrosionsschutzklasse und die gewünschte optische Erscheinung der fertigen Oberfläche. Daneben sind wirtschaftliche Faktoren und gesetzliche Vorgaben zu umweltschutzrechtlichen Beschränkungen zu berücksichtigen. Für Bauteile aus Aluminium oder Edelstahl empfiehlt sich die klassische Passivierung. Gleiches gilt für Projekte, für die eine farblose, gleichmäßig glatte Oxidschicht ohne selbstheilende Wirkung genügt.

Geht es hingegen um galvanisch verzinkte oder stark belastete Teile, die in aggressiven Umgebungen zum Einsatz kommen und haftverbessernde Schichten erfordern, eignet sich das Chromatieren besser. Für Anwendungsfelder mit hohen Umweltstandards empfiehlt sich die gezielte Suche nach chromfreien Alternativen. Tendenziell preiswerter ist das Passivieren. Letztlich hängt die Entscheidung davon ab, ob der Fokus auf maximaler Korrosionsbeständigkeit, dekorativer Wirkung oder Umweltfreundlichkeit liegt. Es gibt bislang kein Chromatisierungs- oder Passivierungsverfahren, das alles gleichermaßen abdeckt, aber einige Optionen, die sehr gute Kompromisse ermöglichen.
Kluthe-Produkte rund um das Chromatieren und Passivieren
Die Chemischen Werke Kluthe haben mit der Produktreihe DECORRDAL ein multimetallfähiges Vorbehandlungssystem entwickelt, das Reinigung, Beizen und Passivieren in einem abgestimmten Prozess kombiniert. Durch das Zusammenfassen dieser drei Schritte lassen sich Metalloberflächen für nachfolgende Chromatierungs- oder Lackierprozesse zeitsparend vorbereiten. DECORRDAL arbeitet mit moderaten Temperaturen und schafft eine energieeffiziente Alternative zu getrennten Einzelschritten.
Für die gezielte Vorbehandlung von Aluminium bietet Kluthe das Produkt HAKUPUR 50-706-2 an. Dieser speziell auf Aluminium abgestimmte Reiniger entfernt organische Verunreinigungen und löst vorhandene Oxidschichten gleichmäßig. Die Anwendung von HAKUPUR 50-706-2 schafft eine gleichförmige Basis für nachfolgende Passivierungs- oder Chromatierungsverfahren.
 Kluthe Magazin
Kluthe Magazin